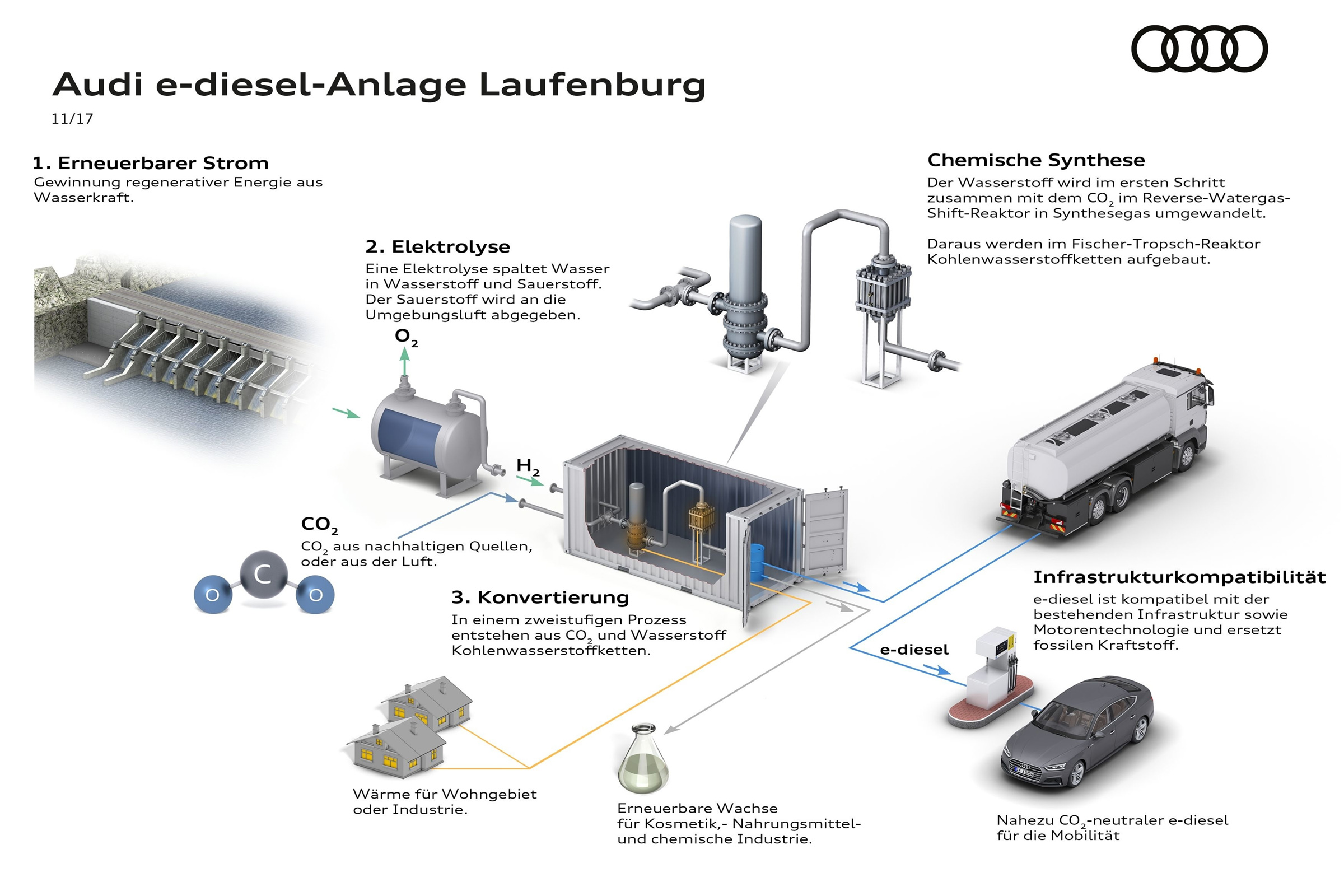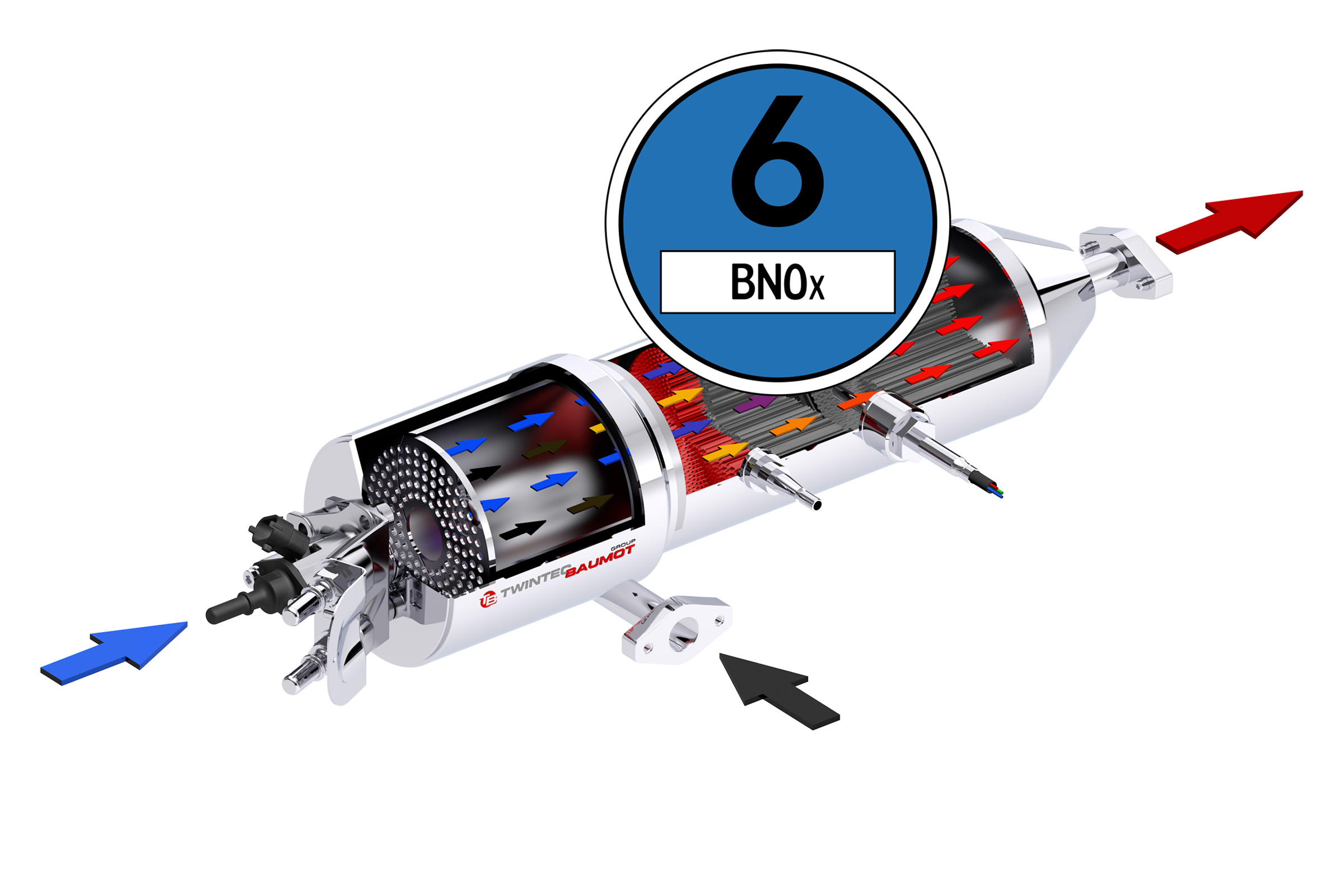Klagen aus der Autoindustrie ist man in Deutschland gewöhnt. Aber die jüngste Äußerung von Thomas Schäfer, Vorstand der Marke Volkswagen im gleichnamigen Konzern, lässt aufhorchen: „Die EU braucht dringend neue Instrumente, um die schleichende De-Industrialisierung noch abzuwenden“, schreibt Schäfer auf LinkedIn. Deutschland und Europa „verlieren rasant an Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit“. Er kritisiert neben hohen Energiepreisen die Europäische Union, deren Regelwerk veraltet und bürokratisch sei: „Die USA dagegen bieten Unternehmen mit dem Inflation Reduction Act hochattraktive Anreize für Investitionen in neue Anlagen und Produktion.“
Der Volkswagen-Vorstand hat damit den Kern eines brisanten Konflikts zwischen den USA und der EU benannt: Mit dem Inflation Reduction Act ist ein gigantisches Subventionsinstrument in Kraft getreten. Das Gesetz wirkt wie ein Magnet auf die internationale Autoindustrie, die ihr Geld für neue Batteriefabriken nun am liebsten in den USA ausgibt.
Konkret erhalten Käuferinnen und Käufer von Elektroautos die Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar ab 2023 nur noch, wenn der Wagen in Nordamerika zusammengebaut wurde. Außerdem müssen mindestens 40 Prozent der Rohmaterialien für die Batterie aus den USA stammen oder aus Ländern, mit denen sie ein Freihandelsabkommen geschlossen hat. Dieser Mindestanteil steigt jährlich um zehn Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2027. Die Liste der Elektroautos, die derzeit die Anforderungen erfüllen, ist kurz und wird von US-Herstellern dominiert.
Der Inflation Reduction Act kombiniert geostrategische Interessen mit Wirtschaftspolitik: Die USA machen sich bei der Herstellung von Elektroautos unabhängig von China. Das geht so weit, dass E-Autos ab 2025 in keinem Fall förderfähig sind, wenn auch nur ein Gramm der Rohstoffe für die Batterie aus China oder Russland kommt. Diese und andere Länder sind Countries of Particular Concern, also frei übersetzt etwa bedenkliche Herkunftsländer. Die entstehende Lücke wird wahrscheinlich durch Minen in Kanada oder Australien geschlossen.
Ein Freihandelsabkommen wäre eine Lösung
Stefan Bratzel vom Center Automotive Management (CAM) an der FHDW Bergisch Gladbach spricht von einem Subventionswettbewerb. „Die Wertschöpfungskette wird bei der Transformation zum Elektroauto neu verteilt“, sagt Bratzel. Viele Autohersteller priorisierten derzeit Investitionen in den USA. Nun sei es an der EU, Lösungen zu finden. „Ein Freihandelsabkommen ist die erste“, sagt Bratzel. „Wir müssen Batteriezellen bei uns in der EU produzieren.“
Eigentlich haben viele Batteriehersteller Fabriken in Europa angekündigt. Deren versprochene Produktionskapazität würde laut der RWTH Aachen im Jahr 2030 ausreichen, um sämtliche neu verkauften Pkw und Lkw zu elektrifizieren und zusätzlich stationäre Speicher für Strom aus erneuerbaren Energien zu konstruieren.
Ankündigungen aber sind keine Taten. Das schwedische Unternehmen Northvolt zum Beispiel, an dem Volkswagen beteiligt ist, gibt sich derzeit zögerlich und ist damit repräsentativ für die Branche. Ab 2025 soll in Schleswig-Holstein ein Werk Batteriezellen ausliefern. Aber die finale Entscheidung für den Standort stehe noch aus, heißt es von Northvolt. Man sei wegen der hohen Energiekosten und der Subventionen in den USA im Gespräch mit der Politik.
Die EU beschränkt sich selbst
„Der Inflation Reduction Act rührt an ein Kerndilemma der Industriepolitik in der Europäischen Union“, sagt Nils Redeker vom Jacques Delors Centre an der Hertie School. Das Beihilferecht verbiete protektionistische Subventionen wie in den USA, weil einzelne finanzstarke Nationen wie Deutschland den Wettbewerb zwischen den EU-Staaten verzerren könnten.
In der aktuellen Situation aber müsse man neu denken, sagt Redeker: „Wir kommen aus meiner Sicht nicht darum herum, eine europäische Industriepolitik zu organisieren.“ Die Finanzierung müsste von allen getragen werden – aber Steuern im herkömmlichen Sinn gibt es in der EU nicht. Bisherige Regeln müssten also umgeschrieben werden.
Von der Leyen will „Klub für kritische Rohstoffe“ gründen
Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, hat bereits eine Reaktion auf den Inflation Redcution Act angekündigt. Die selbstbewusste Industriepolitik der Wettbewerber erfordere eine strukturelle Antwort, sagte von der Leyen. „Wir überlegen, wie unsere Vorschriften über staatliche Beihilfen vereinfacht und angepasst werden können.“ Sie deutete an, dass die Mittel aus dem Förderprogramm IPCEI (Important Projects of Common European Interests) nicht mehr ausschließlich der Forschung an neuen Technologien, sondern auch der Umsetzung zur Verfügung stehen könnten. Wichtig sei jedoch „Zusammenarbeit statt Konfrontation“ mit den USA. Gemeinsam könne man eine Alternative zum Monopol Chinas aufbauen, „indem wir einen Klub für kritische Rohstoffe gründen“.
Der Inflation Reduction Act legt somit die Schwächen der bisherigen EU-Politik offen. Sie hat sich durch den Beschluss, ab 2035 nur noch Elektrofahrzeuge zuzulassen, abhängig von einzelnen Produktions- und Förderländern für Rohstoffe gemacht – und damit erpressbar. Auf dieses Dilemma reagiert die EU bislang zu langsam und zu bürokratisch. Sie ist in ihren eigenen Regeln gefangen.
Erschienen bei ZEIT ONLINE.